Texte
Strukturen der Natur
Die Gemälde und Zeichnungen Michaela Christiane Wiegeles stecken voller Zauber und mystischer Stimmung und erinnern in ihrer meditativen Anmutung an asiatische Malerei oder nebelverhangene Landschaften der deutschen Romantik. Durch ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur, die durch den Menschen fortlaufenden Veränderungen unterworfen ist, gelingt es der Kärntner Künstlerin atmosphärische Räume zu schaffen, die unsere Sinne in Bewegung setzten. Wiegele verwandelt Landschaften in kontemplative Energiebereiche und erweitert auf diesem Wege in vielerlei Hinsicht unser Empfindungsvermögen. Landschaftsraum wird bei der Malerin zu einer Art Zwischenraum, der im Japanischen mit MA bezeichnet und als philosophisch-spirituelle Dimension definiert wird. Ähnlich wie in den dunstigen Naturszenen des englischen Künstlers William Turner oder den visionären Zeichnungen des Franzosen Victor Hugo bewegen sich auch Wiegeles Motive zwischen Figuration und ephemerer Ungegenständlichkeit. Ihr inneres Empfinden scheint in den Bildern gleichsam nach außen gekehrt, Verborgenes offenbart sich in einem diffusen Licht. Michaela Christiane Wiegele schafft es vermittels ihrer Kunst, das naturwissenschaftliche und allzu oft vernunftgeleitete Denken unserer Zeit über Strukturen der Stille und Reduktion in die Sphäre des Geheimnisses zurückzuholen.
Hartwig Knack
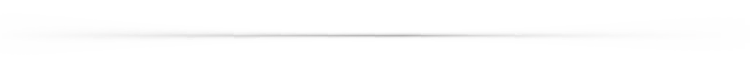
Wie es erscheint
Wie spricht man über Kunst und hier und jetzt über genau diese einzelne Malerei?
Mit einem vergleichenden und vielleicht geschichtlich gebildetem Blick, der historische oder zeitgenössische Parallelen entdeckt, oder Veränderungen, Brüche festhätlt, um sie vielleicht einem unvergleichbaren Modus, einem singulären Stil, im Titel – dem buchstäblich angehängten Zettel – seiner Bezeichnung, oder im Namen dieser singulären Person, der Künstlerin oder des Künstlers zu bezeichnen.
Das Wie des Vergleichens kann Hinweise geben, um genauer zu sehen oder am Unterschied anderes zu entdecken, wenn es sich nicht eindrückt auf die sensible Oberfläche des Gemalten, um in beiden Fällen, der vermeintlichen Gleichheit und den sondierten Unterschieden, sich mit einer Ökonomie des Wiedererkennens zu begnügen. – Eine Ökonomie des Erkennens, das stets Wiedererkennen ist, in der Unbildung wie in der Bildung und Geübtheit, und zumal dann, wenn das Typische als „Brand“ fungiert, ein Brandzeichen des Marktes,
Seltsam – wenn es dann wie zufällig sehr unterschiedlichen Betrachtern – an genau diesem oder jenem Bild geschieht, dass man den scheinbar selben Satz sagt zu etwas, das sich naturgemäß entzieht: dem Licht: Das Licht hier – ein wenig wie bei Turner, aber anderes gemalt und vorallem anders gemalt. Und darum ganz anders in einem notwendig aufkommenden Vergleich.
Noch spricht man. Aber man schaut nicht um zu sprechen. Man hat nicht gesehen, wenn man schaut um zu sprechen. Man hat nicht genug gesehen, und die Dauer verfehlt.
Die Stille vielleicht gerade in diesem Bild, das etwas lauter oder kräftiger entgegenkommt. In diesem, das sich scheinbar einem sanften Verschwinden überlässt. Und in jenem Bereich in diesem Bild, der wie etwas Verwehtes aus der Ferne in sich hineinzieht.
Vorsichtige Metaphern für eine Malerei, die fern von jedem Symbolismus buchstäblich zu sehen gibt,
Wie aber ist das Licht? Kann Licht sein? Das Licht und sonst nichts? Man schweift ab, vielleicht, und im Glücksfall, um sich zu nähern. Die Lichtung vielleicht – als das, was zu sehen gibt. Lichtung* als ein Offenes. Nicht die helle oder dunklere Stelle, sondern das, was über alle Maße hinauszeigt. Ein Draußen, das ohne Maß wäre und also kein anderes Wo ist. Schon spricht man quer zu allen Orientierungen der Sprache.
Also zeigt man: hier diese Kontur, diese Bewegung der Farbe, der Helligkeiten im Dunkel: Dies hier.
Man spricht, um zu zeigen, oder zeigt um das Sprechen in Gang zu halten, es vor seinem Abbruch zu bewahren. Denn es gibt, genau an diesem Abbrechen gibt es – worüber man verwundert sein kann – ein Teilenwollen als Mit-teilen. Zumindest ein Kundgeben: Man sagt nicht mehr unbedingt: das ist schön, vielleicht eher: das ist wirklich gut, oder schlicht: es hat etwas,
Das Etwas – ist es überhaupt das Licht? Das Licht des Himmels oder das des Wassers, buchstäblich.
Das Licht etwa, sofern es uns aus einer Vergangenheit herkommend erreicht, und in der Spektralanalyse erlaubt noch die entferntesten Materien oder Zustände aufzufinden.
Wir machen es hier nicht fest wie das Rot am Zinnober. Und doch hört man nicht auf, es an etwas zu heften, anzuheften, an das, von wo es halb verschluckt vielleicht auf uns zukommt und uns angeht. Umgekehrt hält uns das Erkennen oder Denken von unsichtbaren Relationen, nicht ab von einem scheinbar unvermittelten Da.
Ein Da der Malerei selbst oder das einer Landschaft – deren japanischer Name nach Heidegger eben „Malerei von“ etwas wäre.
Die Sprache aber überspringt es mit dem Unterschied der Darstellung von einem Dargestellten als dieser vorgängig Präsentem, oder in ihr allererst Präsentiertem. Sie nimmt dem Da selbst sein Spiel von Anwesenheit und Abwesenheit.
In dieser Malerei und vielleicht jetzt auf Augenhöhe aber fordert nichts dazu auf, jene Grenzen aufzufinden: Die des Un-Gegenständlichen als eines der Malerei oder eines der Natur. Also die des Geformten, der Form und des Formlosen, selbst wenn man ferner sagen kann: die Grenze des Formlosen der Natur in der Malerei. Das Sehenkönnen bewegt sich immer schon in ihr in dieser bewegten Grenze in der Malerei, in der Natur und in der Natur in der Malerei.
Spricht man also nur um das Unzulängliche der Ökonomie der Sprache zu belegen, um Warnzeichen aufzustellen? Oder gibt es von hier – vielleicht irgendwo unterwegs – auch einen Absprung, etwas, das dem nahe kommt, dem „es hat etwas“, um nicht zu sagen dem, was sich als Einmaliges und Einzelnes entzieht ?
Die Begriffe und ihre Negation, ihr jeweiliges „Ohne“ – Maß, Form, Gestalt usf. – markieren In der Tradition der Ästhetik – von aisthesis, dem Wahrnehmen oder Anschauen herkommend – bis in das Denken der Gegenwart hinein den Unterschied des Schönen und Erhabenen oder Sublimen. Und beiden kommt es auf ihre Weise zu, dem Gewöhnlichen unseres Wahrnehmens und Verstehens, allem voran aber dem identifizierenden Sprechen über etwas als Gegenstand in die Quere zu kommen. Zugleich etabliert sich ihre Unterscheidung am Unterschied des Harmonischen und der Disharmonie, die in sich – erhebend – umschlägt, als eine „negative Lust“, dem Formlosen oder Gewaltigen verbunden. Zwei Weisen der Gestimmtheit, die man nur mühsam jener Verteilung entzieht, wonach man es nicht mit Weisen der Welt im In-der-Welt-sein zu tun hat, sondern mit einem in die Verteilung zu einer Welt aus Objekten eingespannten inneren Gefühl.
Unerachtet dessen wie im transzendentalen Denken Kants das Erhabene als „Geistgefühl“ das Unbedingte der Freiheitsidee bekundet, als völlig losgelöst von einem „Widrigen“, das es auszulösen vermag, markiert es stets eine Grenze der Undarstellbarkeit, den Bezug auf Unendliches als Nichtsinnliches im Sinnlichen.
Dagegen korrespondiert das Schöne im ästhetischen Urteil einer Gunst der Natur oder jener des Betrachters, der ihr mit Gunst begegnet. In der Formalität des Schönen nach Kant ist es unsere – keinem Begriff verpflichtete – „Einbildungskraft, die in der Beobachtung der Gestalt gleichsam spielt“, dann auch radikalisiert verstanden als freies Entwerfen „willkürlicher Formen möglicher Anschauungen“**. Wo wir demnach – im Zuge unseres gewöhnlichen Erkennens als Wiedererkennen – von einem re-präsentierten oder allererst in seinem einmaligen Gesehensein prä-sentierten, der Malerei nicht nur dafür gerade überlassenen, sondern ihr vorgängigen „Gegenstand“ ausgehen, ist nicht minder eine Beweglichkeit des Wahrnehmens in unerschlossene Möglichkeiten des Räumlich-Zeitlichen herausgefordert. So ist es die Malerei, die dieses Vermögen herausfordert und jenes mit ihm verbundene Mögen eröffnet.
Das Sublime aber wird umgekehrt nicht einfach im geforderten Abbruch aller Bezüge erreicht, als wäre dies die Entsprechung zur „rohen“, elementarischen Natur, von der Kant spricht. Zumal der Ruf „The Sublime is now!“ (Barnett Newman) ist seine unmögliche Objektivierung, da es gerade an das >ist< in seiner existenziellen Dimension heranreicht und dabei das >jetzt< aushebelt. Nicht erst Im Unfassbaren geraten die Ordnungen von Zeit und Raum ins Schwanken. Im Unfassbaren, das dem Rohen und Dynamischen, dem Unermesslichen der Natur zu entspringen scheint, wenn die Einbildungskraft versagt, es nicht mehr zu einer möglichen Gestalt zusammenfassen kann.
Sollen wir sagen, die uns überlieferten Begriffe sind hier unangemessen, nicht nur weil man sich ihrer nicht bedienen will, um ohne Scheu in einer, und genau in dieser Malerei ein Beispiel für sie zu finden? Oder kann man jetzt erst und im abspringenden Ausgang von ihnen zu sprechen beginnen?
Ein Schönes im Erhabenen oder vielmehr ein Erhabenes im Schönen. Ein Hinweisen zumindest – mit dieser vielleicht ungehörigen Anwendung.
Wie bewegt sich hier als dieses Licht und diese Farbe der Raum? Als dynamis und energeia – die alten Worte für das Mögliche und Wirkliche. Als Dynamik des Elementarischen, das einem anderen Gesetz gehorcht als jenem, des aus einem Scheitern am Unendlichen oder Widrigen Erhebenden. Es gibt hier nicht den Menschen als kleine Figur des Betrachters. Diese „Malerei von“ erschließt keinen Sehraum, den man wie eine Landschaft betritt, um sich darin zu bewegen. Vielmehr lässt sie das Sehen nie vor sich, sondern nimmt es mit in ihr eigenes Draußen… Ein sanftes Gesetz der Kräfte als energeia.
Es gibt ein Es gibt – das eine Gunst oder Gabe ist. Die Gewalt des Elementarischen ist nicht verschwunden, aber sie ist sublim, Sie zeigt sich in einem anderen Licht, fast wie in einem feinen Pinselstrich.
Gerda Ambos-Oladinni
*Manche Formulierungen hier sind halbwegs, vielleicht notwendig auf halbem Weg und in einem versuchten Zwischendurch an Kant und Heidegger angelehnt. – Zu beiden vergleiche Jacques Derrida: Die Wahrheit in der Malerei (Wien 1992) – ein Titel, der auf ein Zitat Cézannes anspielt.
**Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft §16, §22 f Anm.; Kants umstrittene Grenzziehung gegen die Materialität der Empfindung ist vorallem eine gegen den naiven Empirismus, wonach sich Gesehenes wie ein Stempel in uns einprägt, Und ebenso eine gegen ein Genießen, das sich etwa an bunten Farben erfreut, Die Frage nach einer Differenzialität oder Beweglichkeit im Farbempfinden selbst bleibt dabei aber offen.